Digitale Dienste
Informationsportal

 Hier bin ich:
Hier bin ich:
Stand vom: 03.07.2025
Redaktion bildung-lsa.de auf dem Bildungsserver Sachsen-Anhalt (http://www.bildung-lsa.de/index.php?KAT_ID=13734#art45249)


 | Originalbild von Marcus Kaempf /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
 | Originalbild von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
 | Originalbild von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
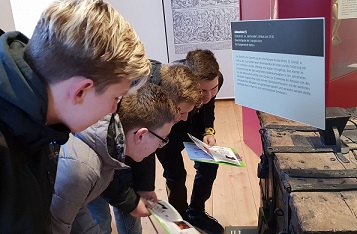 | Originalbild von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
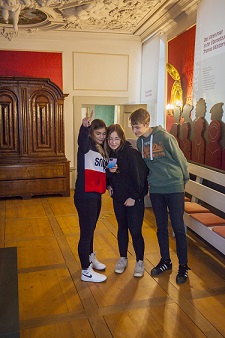 | Originalbild von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
 | Originalbild von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
 | Originalbild von Michael Deutsch, Staatskanzlei und Ministerium für Kultur Sachsen-Anhalt /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
 | Originalbild von LDA Sachsen-Anhalt, A. Hoerentrup /Lizenz: Keine Lizenz |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
 | Originalbild von Alexander Kühne /Lizenz: Keine Lizenz |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
 | Originalbild von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
 | Originalbild von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |
Das Öffnen von Schule und das Lernen im Museum gehört zu den zukunftsträchtigen Bildungsstrategien. Seit 2003 konzipiert das LISA in mehrjährigen Kooperationen unterrichtsunterstützende Bildungsangebote für Museen und begleitet sie bei ihrer Entwicklung zum kulturellen Lernort.
Abgeordnete Lehrkräfte entwickeln ein auf den jeweiligen Lernort zugeschnittenes museumspädagogisches Konzept sowie die dazu geeigneten Medien und Materialien.
Wenn sich Schulklassen angemeldet haben, werden die entstandenen Ergebnisse vor Ort erprobt und den lokalen Bedürfnissen angepasst. Nach der Übergabe der ausgearbeiteten Programme gehen diese in die Verantwortung der Museen über. Das LISA bleibt für weitere drei Jahre Ansprechpartner der Lernorte.
Deutsches Kinderwagenmuseum Zeitz

Die Dauerausstellung des Museums gewährt Einblicke in die historische Entwicklung der "Stadt der Kinderwagen" und der zahlreichen dort ansässigen Unternehmen. Im Deutschen Kinderwagenmuseum Zeitz spiegelt sich somit ein bedeutendes Kapitel der Industriegeschichte Sachsen-Anhalts.
Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 können diese im Rahmen des mehrteiligen Programms „Von Zeitz in die Welt“ erkunden. Neben historisch-kultureller Bildung wird fächerverbindend auch MINT-Bildung vermittelt. Nach einem Einführungsfilm entdecken die jungen Besucher ausgewählte Objekte mit einem Erkundungsheft oder dem Smartphone. Anknüpfend an die nie aus der Kinderwagen-Mode gekommenen Korbflechtarbeiten können sie dann selbst dieses alte Handwerk ausprobieren.
-
Buchungen
Deutsches Kinderwagenmuseum
+49 3441 212546
moritzburg@stadt-zeitz.de
lebekzentrum@stadt-zeitz.de
Kunsthof Bad Salzelmen

Der SOLEPARK zeigt ein Teilstück des einst längsten Gradierwerkes Europas und beleuchtet die Geschichte der Salzgewinnung von den Anfängen bis zur heutigen Nutzung für Kuranwendungen. Das Programm verbindet naturwissenschaftlich-technische Aspekte mit historisch-kulturellen Inhalten. Schülerinnen und Schüler erkunden handlungsorientiert den Kurpark mit seinen Einrichtungen wie dem Schausiedehaus, dem Gradierwerk und dem Trinkbrunnen. Interaktive Experimentierstationen und Materialien zur Vor- und Nachbereitung des Unterrichts sind ebenfalls Teil des Angebots.
Das etwa 180-minütige Programm ermöglicht es den Lernenden, die Bedeutung des Salzes und die Entwicklung der Solekur für die Region Bad Salzelmen kennenzulernen.
-
Ansprechperson für Buchungen
Esther Puder
info@solepark.de
+49 3928 70550
Hüttenmuseum Thale, Mansfeld-Museum Hettstedt, Technikmuseum Magdeburg
„Mit Volldampf in die Moderne“ | Auf dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalts fanden während der Epoche der Industrialisierung entscheidende Entwicklungen statt. Diese Meilensteine der Geschichte werden von verschiedenen Museen des Landes abgebildet. Sie bilden heute Ankerzentren der Industriekultur unseres Landes.
Das Programm „Mit Volldampf in die Moderne“ verbindet das Lernen im historisch-kulturellen Kontext mit den curricularen Vorgaben der Lehrpläne der Fächer Geschichte, Biologie, Chemie, Physik und Technik. Das gesamte Projekt dauert etwa 180 Minuten.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen ersten Einblick in die Thematik durch einen eigens produzierten Einführungsfilm zur Dampfmaschine als Triebfeder der Industrialisierung. Im Film werden nicht nur der technische Fortschritt während der Industrialisierung, sondern auch die Einsatzmöglichkeiten an exemplarischen Standorte vorgestellt.
Die Schülerinnen und Schüler führen selbstständig Modellexperimente zu den thermodynamisch-mechanischen Teilprozessen der Dampfmaschine mit detaillierten Anleitungen durch. Sie gewinnen dabei Erkenntnisse über die Funktionsweise der einzelnen Bauteile und deren Zusammenspiel.

Die betreuten Lernorte und ihre Dampfmaschinen sind das Hüttenmuseum Thale mit einer stationären 1500 PS Dampfmaschine, die als Herzstück des Eisenhüttenwerkes Thale von 1912 bis 1990 drei Walzgerüste des Blockwalzwerkes antrieb, das Mansfeld-Museum im Humboldt-Schloss Hettstedt mit dem Nachbau der ersten Dampfmaschine Watt‘scher Bauart auf deutschem Boden als Grundstein der Industrialisierung und ihre Funktion zur Entwässerung von Grubengebäuden und das Technikmuseum Magdeburg mit der zweiten von R. Wolf Buckau gebauten Lokomobile und einer Transmissionsanlage zur Demonstration der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der erzeugten mechanischen Arbeit.
-
Ansprechpersonen für Buchungen
Hüttenmuseum Thale, Ute Tichatschke
huettenmuseum-thale@t-online.de
+49 3947 778572
Mansfeld-Museum im Humboldt-Schloss, Kerstin Träger
museum@hettstedt.de
+49 3476 200753
Technikmuseum Magdeburg, Janina Lamowski
janina.lamowski@museen.magdeburg.de
+49 391 6223906
Kunstmuseum Moritzburg
Kunst in Diktaturen - NS und DDR | In seiner Sammlungspräsentation "Wege der Moderne" zeigt das Kunstmuseum Moritzburg u. a. Werke aus der Zeit des Nationalsozialismus und der DDR. Neben staatskonformen Kunstwerken können Schülerinnen und Schüler auch solchen begegnen, deren Autoren vom jeweiligen Regime sanktioniert, geächtet oder verfolgt worden sind bzw. nach individuellen Ausdrucksformen in Opposition zur Staatskunst suchten.
Das museumspädagogische Programm "Kunst in Diktaturen" vermittelt Schülerinnen und Schüler ab Klasse 9 anhand ausgewählter Beispiele die Vielfalt bildnerischer Ausdrucksmöglichkeiten unter den spezifischen kunst- und kulturpolitischen Rahmenbedingungen in der Zeit der beiden Diktaturen sowie die Bedeutung von Toleranz, künstlerischer Freiheit als grundlegende demokratische Werte. Die Lernenden erkunden anhand einer interaktiven App auf Tablets selbstständig exemplarische Werke und setzen sich mit den Künstlern und dem historischen Kontext auseinander. Das Programm bezieht sich auf die Lehrpläne der Fächer Kunst, Geschichte, Sozialkunde und Ethik.
Ergänzt wird der thematische Rundgang durch einen bildnerisch-praktischen Teil. Inspiriert durch ein in den 1980er Jahren mithilfe von Großrechnern entstandenes Bild, können die Schülerinnen und Schüler selbst mit digitalen Werkzeugen ein Kunstwerk gestalten.
-
Ansprechpersonen für Buchungen
Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale), Theresa Leschber/Bettina Rost/Bettina Salzhuber
+49 345 21259-40
kunstvermittlung@kulturstiftung-st.de
Museum Lyonel Feininger
Der deutsch-amerikanische Künstler Lyonel Feininger lebte und arbeitete fünfzig Jahre in seiner Wahlheimat Deutschland. In dieser Zeit entwickelte er einen eigenen Stil innerhalb der Klassischen Moderne und reifte zum international beachteten Künstler. 1937 verließ er als von den Nationalsozialisten als "entartet" diffamierter Künstler mit seiner jüdischen Frau seine Wahlheimat und kehrte in die USA zurück.
Die Lyonel-Feininger-Galerie in Quedlinburg präsentiert neben ausgewählten Werken der Malerei und Grafik aus der Sammlung H. Klumpp auch Objekte, die den Künstler als Menschen fassbar machen. Die dramatischen Folgen totalitären Kunstverständnisses werden durch sein persönliches Schicksal für junge Menschen greifbar.
Das fächerübergreifende museumspädagogische Programm für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 9 vermittelt grundlegende Wissensbestände sowie vielfältige allgemeine und fachspezifische Kompetenzen der Lehrpläne Kunst und Geschichte, Sozialkunde und Ethik.

In einem anschließenden Praxisteil können die jungen Besucher ihre Eindrücke vertiefen. Möglich sind verschiedene bildnerische Angebote im Atelier der Galerie sowie die Kombination mit dem folgenden Angebot.
Gestaltung eines Stop-Motion-Films | In der Ausstellung sind die Schülerinnen und Schüler auch den Spielzeugen begegnet, die Feininger für seine Söhne und die Kinder von Freunden aus Holz schnitzte. In Teams lassen sie sich von ähnlich skurrilen Häusern, Figuren und Fabelwesen zu einer kleinen Geschichte inspirieren und produzieren damit einen Stop-Motion-Film. Das Programm dauert etwa 90 Minuten.
Museum Burg und Schloss Allstedt
Aufgrund von Baumaßnahmen im Rahmen einer umfassenden denkmalgerechten Sanierung ist das Museum bis auf Weiteres für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.
Die Geschichte der Allstedter Burg- und Schlossanlage reicht bis ins 9. Jahrhundert zurück. An der Straße der Romanik gelegen lässt sich dort die Bau- und Nutzungsgeschichte vom 13. bis zum 19. Jahrhundert nachvollziehen. Als Wirkungsstätte Thomas Müntzers ist sie ein bedeutender Ort der Reformationsgeschichte.
Mit Blick auf die Jahre 1523, als Müntzer in Allstedt seine Arbeit als Pfarrer aufnahm und 1524, dem Jahr seiner berühmten Fürstenpredigt können Schülerinnen und Schüler die Dauerausstellung „Thomas Müntzer- ein Knecht Gottes“ selbstständig erkunden und sich ein eigenes Bild vom widersprüchlichen Theologen und Reformator machen.
In der Schlossküche und der Hofstube begeben sie sich in die Zeit des späten Mittelalters, der Renaissance und des Barocks. Alle thematischen Erkundungen sind mit passenden Praxisangeboten kombiniert.
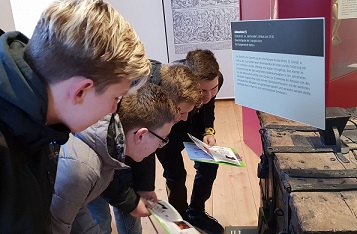
Zwei wählbare praktische Angebote vertiefen das Gelernte. Es besteht die Möglichkeit, die Ereignisse um den Reformator in einem digital gestalteten Comic nachzuerzählen. Das entstandene Comic kann gebunden mitgenommen werden. Angelehnt an die Flugblätter der Reformationszeit können Zitate Müntzers mit beweglichen Lettern gesetzt und kombiniert mit seinem Porträt auf einer historischen Presse gedruckt werden. Inklusive einer Pause dauert das Programm etwa 3,5 Stunden.
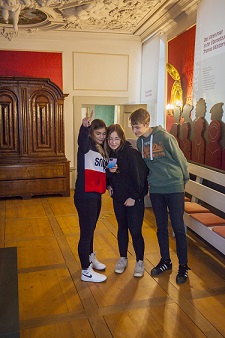
Ein sich anschließendes Praxisangebot bietet die Möglichkeit, sich mit den barocken Intarsien-Arbeiten im Schloss handwerklich und kreativ auseinanderzusetzen. Das Programm dauert inklusive Pause ca. 4 Stunden.

-
Ansprechperson für Buchungen
Sonja Becker
schloss-allstedt@allstedt.de
+49 34652 519
Kloster Memleben

Lernort und Programm werden auf einer DVD vorgestellt, die über die Mediathek des LISA ausgeliehen werden kann.
Naumburger Dom
Die Programme unter dem Titel „Hand-Werke(n) in der Hütte des Meisters " wurden im Rahmen der Betreuung kultureller Lernorte durch das LISA von 2008 bis 2012 gemeinsam mit den Vereinigten Domstiftern zu Merseburg und Naumburg und dem Kollegiatstift Zeitz erarbeitet. In der Kinderdombauhütte des Naumburger Domes können Schülerinnen und Schüler als Steinmetze und Kunstglaser tätig werden und ein mittelalterliches Bauwerk aus der Sicht seiner Schöpfer kennenlernen.

Der Umgang mit Material und Werkzeugen in diesem Projekt erfordert ein geduldiges Vorgehen. Die Arbeitszeiten können je nach Geschicklichkeit der Teilnehmer und Größe der Gruppe stark variieren. Sie sollten mind. 4 Stunden für dieses Programm einplanen.
 Botanik in Stein | Gotische Kathedralen beinhalten eine große Vielfalt an steinernem Pflanzenschmuck. Für manche Betrachter tragen sie gar den Charakter botanischer Lehrwerke. Neben der symbolischen Verwendung von Pflanzen wie dem Weinstock oder dem Ölbaum zeigen die Kunstwerke das Streben der gotischen Meister, die Natur nachzubilden. Am Westlettner des Naumburger Domes sind Beispiele dieser Kunstfertigkeit zu finden. Neben einer Einführung in die Welt der Steinmetzen im 13. Jahrhundert und der Erkundung der Flora und Fauna im Naumburger Dom im Stil einer Safari beinhaltet das Programm die Gelegenheit, die oft bewunderte Genauigkeit der Pflanzendarstellungen am Westlettner mit Hilfe eines speziell entwickelten Bestimmungsschlüssels zu prüfen. Die so erkundete Pflanze kann ggf. mit dem natürlichen Vorbild im Garten des Naumburger Meisters verglichen werden, bevor sich die Schüler mit den mittelalterlichen Steinmetzwerkzeugen selbst an der steinernen Nachbildung eines Pflanzenmotivs versuchen können. Das Programm dauert etwa 3 Stunden.
Botanik in Stein | Gotische Kathedralen beinhalten eine große Vielfalt an steinernem Pflanzenschmuck. Für manche Betrachter tragen sie gar den Charakter botanischer Lehrwerke. Neben der symbolischen Verwendung von Pflanzen wie dem Weinstock oder dem Ölbaum zeigen die Kunstwerke das Streben der gotischen Meister, die Natur nachzubilden. Am Westlettner des Naumburger Domes sind Beispiele dieser Kunstfertigkeit zu finden. Neben einer Einführung in die Welt der Steinmetzen im 13. Jahrhundert und der Erkundung der Flora und Fauna im Naumburger Dom im Stil einer Safari beinhaltet das Programm die Gelegenheit, die oft bewunderte Genauigkeit der Pflanzendarstellungen am Westlettner mit Hilfe eines speziell entwickelten Bestimmungsschlüssels zu prüfen. Die so erkundete Pflanze kann ggf. mit dem natürlichen Vorbild im Garten des Naumburger Meisters verglichen werden, bevor sich die Schüler mit den mittelalterlichen Steinmetzwerkzeugen selbst an der steinernen Nachbildung eines Pflanzenmotivs versuchen können. Das Programm dauert etwa 3 Stunden.
Stadtmuseum Halle
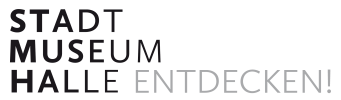 Das LISA hat dem Stadtmuseum Halle eine museumspädagogische Konzeption für Schülerinnen und Schüler übergeben. Die Dauerausstellungen zur Stadtgeschichte und zum Zeitalter der Aufklärung können nun zur Ergänzung des Unterrichts genutzt werden. Die entstandenen Programmangebote beziehen sich auf zwei Themenbereiche:
Das LISA hat dem Stadtmuseum Halle eine museumspädagogische Konzeption für Schülerinnen und Schüler übergeben. Die Dauerausstellungen zur Stadtgeschichte und zum Zeitalter der Aufklärung können nun zur Ergänzung des Unterrichts genutzt werden. Die entstandenen Programmangebote beziehen sich auf zwei Themenbereiche:
Christian Wolff - Gelehrsamkeit und Geselligkeit im 18. Jahrhundert | Unter diesem Titel sind drei Programme im Museum entstanden, die sich mit der Ausstellung "Geselligkeit und Freyheit zu philosophieren" sowie den Wohn- und Arbeitsräumen von Christian Wolff befassen. Diese Programme richten sich besonders an Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 und 8 und bieten einen Einblick in die Bedeutung Christian Wolffs als Vordenker der deutschen Aufklärung sowie in die Geselligkeitskultur des 18. Jahrhunderts.
Der Erkundungsrundgang „Christian Wolff – Und der Mensch zu wissen begierig ist“ beginnt im Auditorium Christian Wolffs. Nach einer Begrüßung durch die Museumspädagogin und den Sohn Christian Wolffs erkunden die Jugendlichen mit einem Erkundungsheft die Ausstellung und diskutieren anschließend ihre Eindrücke.
Im Erkundungsrundgang „Geselligkeit vor 250 Jahren“ liegt der Fokus auf den Facetten der Geselligkeit im 18. Jahrhundert. Nach der Erkundung der Ausstellung diskutieren die Teilnehmenden ihre Erkenntnisse und vergleichen die damalige Geselligkeit mit der heutigen.
Der Actionbound „Christian Wolff – Gelehrsamkeit und Geselligkeit im 18. Jh.“ bietet eine interaktive Erkundung der Ausstellung. Mit einem QR-Code können die Schülerinnen und Schüler die Ausstellung auf eigene Faust oder in geführten Gruppen erkunden und dabei Quizaufgaben lösen.
Jedes Programm wird durch eine praktische Vertiefung ergänzt, bei der die Teilnehmenden eine Sammlungsbox oder ein persönliches Stammbuch gestalten. Diese kreativen Arbeiten werden am Ende des Museumsbesuchs vorgestellt und reflektiert.
Die Lernerlebnisprogramme dauern jeweils zwei Stunden.
40 Jahre DDR – Leben in Halle | Das Programm erschließt vielfältige und interessante Objekte der halleschen Kultur- und Sozialgeschichte zum Leben in Halle während der 40 Jahre DDR. Schülerinnen und Schüler können durch abwechslungsreiche Materialsammlungen auf Tablets, darunter Videos, Audios und Dokumente, die Ausstellungsstücke entdecken.
Nach einer Begrüßung und Einführung wählen die Teilnehmenden ein Thema zur Erkundung aus. Zur Auswahl stehen unter anderem die Entwicklung der Altstadt Halles, die Entstehung von Halle-Neustadt als sozialistische Musterstadt, das Leben als Jugendliche in der DDR, sowie Kunst, Sport und Vereine in dieser Zeit. Weitere Themen sind die Produktion in Halle, das Leben zwischen SED-Politik und Bürgerprotest, Sehnsüchte der Bevölkerung und Umweltprobleme in der Chemieregion.
In Gruppen von bis zu vier Jugendlichen erkunden die Teilnehmenden selbstständig die Ausstellung zu ihrem gewählten Schwerpunkt. Anschließend bereiten sie eine Präsentation vor, um ihre Erkenntnisse und Eindrücke den Mitschülerinnen und Mitschülern anschaulich darzulegen. Nach den Präsentationen werden die Ergebnisse verglichen und diskutiert. Die Möglichkeit, die Präsentationen für eine Nachbereitung in der Schule zu speichern, ist ebenfalls gegeben.
Zum Abschluss reflektieren die Schülerinnen und Schüler ihre Eindrücke vom Museumsbesuch und bewerten diesen. Das Programm dauert etwa vier Stunden und bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit der DDR-Geschichte in Halle.
Kulturhistorisches Museum Schloss Merseburg

Weitere kulturelle Lernorte

Dafür sind kulturelle Einrichtungen Sachsen-Anhalts sowie Mitteldeutschlands miteinander in Kontakt getreten, um auf der Basis dieser Vernetzung verschiedene Akteure miteinander ins Gespräch zu bringen, die bereits bestehenden Angebote aufzuzeigen sowie Ideen und Visionen für die zukünftige Gestaltung außerschulischer Lernorte mit Antikenbezug zu entwickeln.
Im Sinne einer Vernetzung von erster, zweiter und dritter Fortbildungsphase der Altsprachenlehrkräfte geht der Impuls von der Didaktik der Alten Sprachen an der MLU Halle-Wittenberg aus und ist unter Einbezug der Referendariatsausbildung auf die Sichtbar- und Nutzbarmachung der antikerelevanten Kulturschätze für Latein- und Griechischlehrkräfte sowie andere Interessierte ausgerichtet.


 Kunsthof Solepark Bad Salzelmen
Kunsthof Solepark Bad Salzelmen